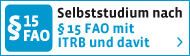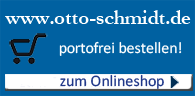LG Memmingen v. 13.6.2024, 24 O 1624/23
Scraping: Kein Schadensersatz wegen Datenübermittlung
Dass bloße negative Gefühle wie Unmut, Unzufriedenheit, Sorge und Angst, die an sich Teil des allgemeinen Lebensrisikos und oft des täglichen Erlebens sind, Grundlage für einen Schadensersatzanspruch sein können, hält das Gericht jedenfalls dann für nicht gerechtfertigt, wenn kein Einfluss auf die Lebensführung ersichtlich und damit ein konkreter Rückschluss von äußeren Umständen auf diese inneren Tatsachen nicht möglich ist.
Der Sachverhalt:
Die Beklagte erbringt Telekommunikationsdienstleistungen. Sie ist für die in diesem Zusammenhang erfolgenden Datenverarbeitungen die datenschutzrechtliche Verantwortliche. Der Kläger hatte bei der Beklagten einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. Wie üblich meldete die Beklagte einen bestimmten Datensatz über diesen Vertragsschluss an die SCH. Konkret übermittelte sie folgende Daten an die SCH: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Daten von Beginn und Ende eines Telekommunikationsvertrags, Vertragsnummer sowie Meldemerkmal „SK“ – Servicekonto zum Telekommunikationskonto.
Der Kläger gab an, er habe am 26.6.2023 von der SCH eine Auskunft erhalten, in welcher u.a. folgender Eintrag enthalten war:
„Am 3.3.2022 hat ... den Abschluss eines Telekommunikationsvertrages gemeldet und hierzu das Servicekonto unter der Nummer ... übermittelt. Diese Information wird gespeichert, solange die Geschäftsbeziehung besteht“.
Der Kläger behauptete, bei ihm habe sich aufgrund der unberechtigten Datenübermittlung ein Gefühl des Kontrollverlustes und der großen Sorge, insbesondere auch wegen der eigenen Bonität, eingestellt. Seitdem er mit ständiger Angst. Die Beklagte habe mit der Einmeldung bei der SCH gegen Art.6 Abs. 1 sowie Art. 5 Abs. 1 a) DSGVO verstoßen, weil es sich um eine unrechtmäßige Übermittlung der Daten des Klägers gehandelt habe. Eine solche sei für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich gewesen, ein rechtmäßiges Interesse habe darüber hinaus ebenfalls nicht vorgelegen.
Das LG hat die auf mindestens 5.000 € Schadensersatz gerichtete Klage abgewiesen.
Die Gründe:
Dem Kläger steht kein Anspruch auf Ersatz des (immateriellen) Schadens gem. Art. 82 Abs. 1 DSGVO i.V.m. Art. 6 Abs. 1, 5 Abs. 1 a) DSGVO zu.
Vorliegend fehlte es bereits an einem ersatzfähigen Schaden des Klägers i.S.v. Art. 82 Abs. 1 DSGVO, sodass über die weiteren Umstände nicht zu entscheiden war. Laut OLG München (Urt. v. 24.4.2024 – 34 U 2306/23) ist ein immaterieller Schaden nicht bereits in einem Kontrollverlust zu sehen, der durch das Scraping entstanden ist, sondern kann allenfalls Folge dieses Kontrollverlustes sein (so zutreffend OLG München 27 U 2408/23 e, Beschl. v. 2.2.2024). Die hieraus folgende Dreistufigkeit der Prüfung (Verstoß gegen DSGVO -> negative Folge, z.B. Kontrollverlust -> Schaden) stellt auch der EuGH in seinem Urteil vom 14.12.2023 (C-340/21) heraus. Der EuGH hat zuletzt ausdrücklich entschieden, dass nicht schon deshalb ein „immaterieller Schaden“ i.S.v. Art. 82 Abs. 1 DSGVO vorliegt, weil die betroffene Person befürchtet, dass in der Zukunft eine Weiterverbreitung oder gar ein Missbrauch ihrer Daten stattfindet (Urt. v. 25.1.2024, C-687/21).
Schließlich ließ sich auch der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen dem Scraping-Vorfall und den von ihr behaupteten Unannehmlichkeiten nicht sicher feststellen. Zwar stand nach dem Vortrag des Klägers das vermehrte Auftreten von belästigenden Anrufen in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Scraping-Vorfall. Das allein konnte aber keinen Kausalzusammenhang belegen, denn derartige unerbetene, belästigende oder betrügerische Anrufe können grundsätzlich schon deshalb nicht gerade auf den Scraping-Vorfall bei … zurückgeführt werden, da es allgemein – und auch den Senatsmitgliedern aus eigener Erfahrung – bekannt, dass Personen, die keine sozialen Netzwerke nutzen, ebenfalls derartige Anrufe erhalten.
Für den Beweis nach § 286 ZPO ist die volle richterliche Überzeugung erforderlich. Diese kann nicht mit mathematischen Methoden ermittelt und darf deshalb nicht allein auf mathematische Wahrscheinlichkeitsberechnungen gestützt werden. Die Kammer konnte im Rahmen der informatorischen Anhörung nicht die Überzeugung gewinnen, dass der Kläger aufgrund eines Kontrollverlusts an Existenzängsten, Stress oder allgemeinem Unwohlsein leidet. Dass bloße negative Gefühle wie Unmut, Unzufriedenheit, Sorge und Angst, die an sich Teil des allgemeinen Lebensrisikos und oft des täglichen Erlebens sind, Grundlage für einen Schadensersatzanspruch sein können, hält das Gericht jedenfalls dann für nicht gerechtfertigt, wenn kein Einfluss auf die Lebensführung ersichtlich und damit ein konkreter Rückschluss von äußeren Umständen auf diese inneren Tatsachen nicht möglich ist (vgl. auch OLG Dresden, Urt. v. 5.12.2023 – 4 U 709/23).
Mehr zum Thema:
Beratermodul IT-Recht:
Die perfekte Online-Ausstattung für das IT-Recht: Stets auf dem aktuellsten Stand mit den Inhalten aller Ausgaben von Computer und Recht und IT-Rechtsberater sowie den Updates von Redeker, Handbuch der IT-Verträge. Hier das informative Rezensions- und Anwendungsvideo von RA Michael Rohrlich und Marc Oliver Thoma ansehen! Bearbeiten Sie zahlreiche bewährte Formulare mit LAWLIFT! 4 Wochen gratis nutzen!
Beratermodul Datenschutzrecht:
Die perfekte Online-Ausstattung für das Datenschutzrecht (DSGVO/BDSG). Jetzt mit Top-Inhalten zum Datenschutzrecht aus dem C.F. Müller Verlag. Hier das informative Rezensions- und Anwendungsvideo von RA Michael Rohrlich und Marc Oliver Thoma ansehen! Bearbeiten Sie zahlreiche bewährte Formulare mit LAWLIFT! 4 Wochen gratis nutzen!