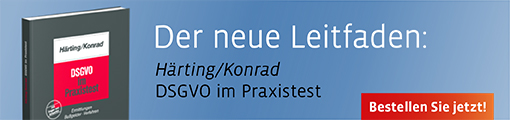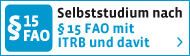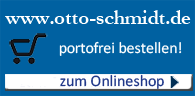Im März 2025 wird die 8. Auflage des Handbuchs zum Internetrecht von RA Prof. Niko Härting erscheinen. Der vorliegende Beitrag aus dem Kapitel „Wettbewerbsrecht“ soll einen Einblick in das neu gestaltete Werk geben. Er befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Influencer, wenn diese auf ihren Kanälen für das eigene Unternehmen oder für Dritte werben.
Influencer sind gemäß § 5a Abs. 4 Satz 1 UWG und § 6 Abs. 1 Nr. 1 DDG verpflichtet, ihre Beiträge als Werbung zu kennzeichnen, wenn sie als Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG agieren. Die Rechtsprechung unterscheidet hierbei zwischen der Werbung für ein fremdes Unternehmen (bezahlte Werbung) und der Werbung für das eigene Unternehmen.
In Bezug auf die frühere Fassung von § 5a Abs. 4 Satz 1 UWG (damals § 5a Abs. 6 UWG) vertrat der BGH die Auffassung, dass diese Vorschrift durch § 6 Abs. 1 Nr. 1 DDG (ehemals § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG) verdrängt werde. Ob der BGH diese Auffassung nach der letzten Novelle des UWG weiterhin aufrechterhält, bleibt abzuwarten, da die Formulierungen in § 5a Abs. 4 UWG nun an das DDG angepasst wurden.
(1) Unternehmensbegriff
Laut § 2 Abs. 1 Nr. 8 UWG ist ein Unternehmer jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, sowie jede Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen Person handelt. Für Influencer ist insbesondere ihre gewerbliche Tätigkeit von Bedeutung. Sie müssen selbstständig, planmäßig und auf eine gewisse Dauer eine entgeltliche Leistung am Markt anbieten.
(2) Werbung für das eigene Unternehmen
Influencer gelten als Unternehmer, wenn sie selbst Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Ebenso handeln sie als Unternehmer, wenn sie in den sozialen Medien ihr eigenes Image vermarkten und kommerzialisieren. Dies gilt vor allem dann, wenn Social-Media-Beiträge darauf abzielen, die Bekanntheit und den Werbewert des Influencers zu steigern und so das Interesse von Drittunternehmen für Kooperationen zu wecken. Die Beeinflussung des Konsumverhaltens der Follower ist hingegen für die Beurteilung der Unternehmereigenschaft unerheblich.
(3) Werbung für Dritte
Erhält ein Influencer für einen werblichen Beitrag eine Gegenleistung, stellt dieser Beitrag eine geschäftliche Handlung zugunsten des beworbenen Unternehmens dar. Dies gilt analog zu entgeltlichen Anzeigenschaltungen in der Presse.
Ohne eine solche Gegenleistung liegt jedoch nicht automatisch eine geschäftliche Handlung vor. In diesem Fall muss geprüft werden, ob der Influencer vor allem den Absatz fremder Produkte oder andere, insbesondere redaktionelle Ziele, verfolgt, wobei auch das Informationsinteresse der Follower berücksichtigt wird. Nur weil Follower den Lebensstil eines Influencers als Inspiration für ihre eigene Lebensgestaltung übernehmen und nachahmen, kann nicht ohne Weiteres geschlossen werden, dass der Influencer vorrangig den Absatz fremder Produkte fördert.
Bei der Beurteilung von Influencer-Beiträgen in sozialen Medien können ähnliche Kriterien angewendet werden, die auch für die Bewertung redaktioneller Presseartikel als Werbung entwickelt wurden. Auch wenn ein klassisches Medienunternehmen für eine scheinbar redaktionelle Veröffentlichung keine Gegenleistung von einem fremden Unternehmen erhält, kann es sich dennoch um eine geschäftliche Handlung zugunsten dieses Unternehmens handeln, wenn der Beitrag insgesamt einen übertrieben werblichen Eindruck macht. Ein werblicher Überschuss kann zum Beispiel dann vorliegen, wenn ein Produkt in einem Instagram-Beitrag in übermäßig euphorischer Weise angepriesen wird. Eine hohe Anzahl an Followern kann ebenfalls als Indiz für eine geschäftliche Handlung dienen.
Ein Link, der auf die Website des Herstellers eines beworbenen Produkts verweist, kann nach Ansicht des BGH regelmäßig als werblicher Überschuss gewertet werden, da der Leser durch das Klicken auf den Link direkt in den werblichen Einflussbereich des Herstellers gelangt.
(4) Entbehrlichkeit der Kennzeichnung
Eine Kennzeichnungspflicht besteht gemäß § 5a Abs. 4 Satz 1 UWG nur dann, wenn der kommerzielle Zweck eines Beitrags nicht „unmittelbar aus den Umständen“ erkennbar ist. Das bedeutet, dass eine Kennzeichnung entbehrlich sein kann, wenn der werbliche Charakter eines Beitrags für den Verbraucher auf den ersten Blick eindeutig erkennbar ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Verbraucher durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig ist.
Es reicht nicht aus, dass der werbliche Charakter eines Beitrags erst nach vollständigem Lesen erkennbar wird. In einem solchen Fall hätte der Verbraucher bereits der Anlockwirkung des Beitrags nachgegeben, die durch die Kennzeichnungspflicht verhindert werden soll.
Das allgemeine Wissen der Nutzer über die Finanzierung von Instagram-Profilen durch Werbekooperationen steht einer Kennzeichnungspflicht einzelner Beiträge nicht entgegen. Die Kennzeichnung soll dem Verbraucher ermöglichen, den kommerziellen Charakter eines Beitrags von vornherein zu erkennen, um ihn kritisch zu hinterfragen oder ihm zu entkommen.
Fehlt es an einer Gegenleistung für den Beitrag, ist keine Kennzeichnungspflicht gemäß § 5a Abs. 4 Satz 2 UWG gegeben. Der Erhalt einer Gegenleistung wird jedoch vermutet (§ 5a Abs. 4 Satz 3 UWG).
(5) Kennzeichnung
Das OLG Celle und das LG Heilbronn sind der Ansicht, dass es nicht ausreicht, wenn ein Influencer den Hashtag „#ad“ in die Hashtags seines Beitrags aufnimmt. Die Mehrheit der Leser wird diesen Hashtag vermutlich nicht sofort beachten, sodass der kommerzielle Charakter des Beitrags nicht hinreichend erkennbar wird.