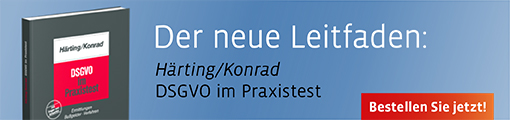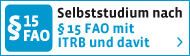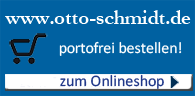Ein Beitrag von Niko Härting und Jan Hemann
Social Media boomt: Instagram, TikTok und Co. sind Orte, die Millionen Menschen zwar vor allem zur Unterhaltung nutzen, die aber auch den einzelnen Nutzer dazu anregen, sich – sein Leben und Aussehen – in ein besonders positives Licht zu rücken. Erfüllt man die Anforderungen an das allseits vermittelte Schönheitsideal der Timothée Chalamets und Kylie Jenners des Internets nicht, bieten einschlägige Werbeseiten für Schönheitseingriffe auf den Plattformen sogleich den Lösungsvorschlag. Um den Nutzer mit Erfolgen zu locken, greift man besonders gerne auf die beliebte Methode der „Vorher-Nachher“-Darstellungen zurück. In Deutschland sind diese Darstellungen jedoch in aller Regel verboten.
Hintergrund
§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) besagt, dass die Wirkung der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 lit. c) HWG genannten „operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe zur Veränderung des menschlichen Körpers ohne medizinische Notwendigkeit“ nicht „durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff“ beworben werden darf. Relevanz erlangt diese Norm vor allem in ihrer Rolle als marktregelnde Norm i.S.d. § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Nach § 3a UWG handelt unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die jedenfalls auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, wenn der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.
In jüngerer Zeit gab es hierzu eine Menge an Streitfällen in der obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. OLG Koblenz, Urt. v. 23.4.2024 – 9 U 1097/23; OLG Köln, Urt. v. 27.10.2023 – 6 U 77/23; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.02.2022 – 15 U 24/21). Besonders streitig ist die Reichweite des Verbots, also die Frage, ab wann genau von einem operativen Eingriff auszugehen ist.
Zu entscheidender Sachverhalt
Am 3.7.2025 hat der BGH das Thema auf dem Tisch. Anlass dazu gibt ein vom OLG Hamm entschiedener Fall (Urteil vom 29.8.2024 – 4 UKl 2/24). Die auf Unterlassung Beklagte bot in ihrer Praxis ästhetische Gesichtsbehandlungen an und bewarb diese sowohl auf ihrer Website als auch auf Instagram durch Beiträge, die Vorher-Nachher-Bilder von Patienten zeigten. Die Klägerin, eine Verbraucherzentrale, war der Ansicht, dass die Bewerbung gegen § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 HWG verstoße.
Die Beklagte machte hingegen geltend, dass das angewandte Verfahren, bei welchem Hyaluronsäure oder Botox in das Gesicht mittels einer Nadel oder einer Kanüle injiziert wird, aber keine Skalpelle oder anderweitigen, für Operationen relevanten Instrumente verwendet werden, bereits dem Wortlaut nach weder als „operatives“ noch als „plastisch-chirurgisches“ Verfahren bezeichnet werden könne (OLG Hamm, Urt. v. 29.8.2024- 4 UKl 2/24, Rn. 16).
Ansatz der Vorinstanz OLG Hamm
Das OLG Hamm sah diesen Umstand jedoch als nicht entscheidend an. Vielmehr liege ein operativer Eingriff bereits dann vor, wenn im Rahmen des instrumentellen Eingriffs am menschlichen Körper „Form- und Gestaltveränderungen an den Organen oder der Körperoberfläche vorgenommen werden“. Zur Begründung rückte das Gericht vor allem den Schutzzweck des Heilmittelwerbegesetz in den Fokus. Dieser sei weit zu verstehen und erfasse demnach nicht allein operative Eingriffe im engeren Sinne, also solche, die durch Öffnung des Körpers mittels Skalpell oder Messer erfolgen. Auch wenn bei Eingriffen, die keinen operativen Eingriff im engeren Sinne darstellen, ein erheblich geringeres Gesundheitsrisiko bestehe, seien die Risiken nicht von der Hand zu weisen (OLG Hamm, Urt. v. 29.8.2024- 4 UKl 2/24, Rn. 37 f.).
Chance für den BGH
Dem BGH obliegt es nun, zwischen dem Wortlaut auf der einen und dem Schutzzweck auf der anderen Seite eine Entscheidung zu treffen. Sollte er die bisherige obergerichtliche Rechtsprechung umkehren, dürften Unternehmen und Dienstleister durchatmen können. Die Entscheidung bietet somit das Potenzial, die Gestaltung von Inhalten auf sozialen Plattformen langfristig zu prägen.